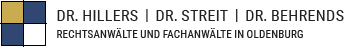31.03.14 | Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 10.10.2013 zu dem gerichtlichen Aktenzeichen IX ZB 229/11 zu der Frage Stellung genommen welche Anforderungen an die öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzsachen im Internet zu stellen sind.
Ausgangspunkt der Entscheidung war ein Insolvenzverfahren, in welchem anlässlich der erfolgten Veröffentlichung des Beschlusses über die Durchführung einer Anhörung der Gläubiger nach § 197 Abs. 2 und Abs. 5 InsO lediglich der Nachnahme des Schuldners veröffentlicht wurde.
Die Leitsätze der zitierten Entscheidung lauten:
1. Bei der öffentlichen Bekanntmachung von Beschlüssen des Insolvenzgerichts im Internet auf der länderübergreifenden Justizplattform www.insolvenzbekannt-machungen.de ist der zu veröffentlichende Beschluss des Insolvenzgerichts einschließlich des Vornamens des Schuldners einzugeben.
2. Die fehlende Angabe des Vornamens des Schuldners kann dazu führen, dass die Veröffentlichung keine Wirkungen entfaltet, weil die notwendige Unterscheidungskraft nicht gewahrt ist; die Angabe des Vornamens wird durch die Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzsachen im Internet nicht ausgeschlossen.
3. Einem Gläubiger kann entsprechend den Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellungnahme zu dem Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung zu gewähren sein, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass er den Beschluss über die Ingangsetzung der Anhörungsfrist nicht entdeckt hat, weil er aufgrund der unzureichenden Erläuterungen auf der Suchmaske des länderübergreifenden Justizportals nicht bemerkt hat, dass er den Vornamen des Schuldners nicht eingeben darf, um vollständige Suchergebnisse zu erhalten.
4. Mit der Wiedereinsetzung des Gläubigers in die Frist zur Geltendmachung von Versagungsgründen wird die Rechtzeitigkeit seines Versagungsantrags fingiert; die auf das Fehlen von Versagungsanträgen gestützte Erteilung der Restschuldbefreiung entfällt, ohne dass es der förmlichen Aufhebung dieses Beschlusses bedarf.
Nach § 1 Satz 1 der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen im Insolvenzverfahren im Internet vom 12.02.2002 (BGBl. I, 677) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2007 (BGBl. I, 509), nachfolgend InsOBekVO haben öffentliche Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet den Anforderungen der Verordnung zu entsprechen. Satz 2 schreibt vor, dass die Veröffentlichung nur die personenbezogenen Daten enthalten darf, die nach der InsO oder nach anderen Gesetzen, die eine öffentliche Bekanntmachung in Insolvenzverfahren vorsehen, bekannt zu machen sind. § 4 InsOBekVO bestimmt, dass die Insolvenzgerichte sicherstellen müssen, dass jemand von den öffentlichen Bekanntmachungen in angemessenem Umfang unentgeltlich Kenntnis nehmen kann. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 InsOBekVO ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Daten spätestens nach dem Ablauf von zwei Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung (also noch vor Ablauf der Frist zur Einlegung der sofortigen Beschwerde) nur noch abgerufen werden können, wenn die Abfrage den Sitz des Insolvenzgerichts und mindestens eine der folgenden Angaben enthält:
a) den Familiennamen,
b) die Firma,
c) den Sitz oder Wohnsitz des Schuldners,
d) das Aktenzeichen des Insolvenzgerichts oder
e) Registernummer und Sitz des Registergerichts.
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 InsOBekVO können die Angaben nach Satz 1 Nr. 3 lit. a bis e unvollständig sein, sofern sie Unterscheidungskraft besitzen. Dabei führt die fehlende Angabe des Vornamens nach der Auffassung des BGH, dass die Veröffentlichung keine Wirkungen entfalten kann. Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachungen muss sich daran ausrichten, dass die Adressaten in die Lage versetzt werden, ihre Rechte wahrzunehmen, derentwegen die Bekanntmachung erfolgt. Hierzu ist der Schuldner genau zu bezeichnen.
Fehlen die in § 9 Abs. 1 Satz 2 InsO angegebenen Mindestanforderungen, zu denen die genaue Bezeichnung des Schuldners gehört, ist die öffentliche Bekanntmachung wirkungslos. Demzufolge war im vorliegenden Fall der Gläubigerin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.
BGH, Beschluss vom 10.10.2013, Az.: IX ZB 229/11, siehe u. a. NJW-RR 6/2014, 369 ff.