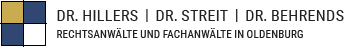19.11.13 | Der Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung ist unzulässig, wenn er innerhalb von drei Jahren nach Versagung der Restschuldbefreiung in einem früheren Verfahren wegen fehlender Deckung der Mindestvergütung des Treuhänders gestellt worden ist (BGH, Beschluss vom 07.05.2013, Az.: IX ZB 51/12).
Dem Schuldner wurde nach Verfahrensaufhebung mit rechtskräftigem Beschluss vom 01.07.2010 auf Antrag des Treuhänders wegen der fehlenden Deckung der Mindestvergütung die Restschuldbefreiung versagt. Im April 2011 beantragte der Schuldner erneut die Verfahrenseröffnung und die Erteilung der Restschuldbefreiung. Das Insolvenzgericht hat den Antrag als unzulässig abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem BGH keinen Erfolg.
Ein erneuter Antrag auf Restschuldbefreiung ist mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, wenn er innerhalb von drei Jahren nach rechtskräftiger Versagung gem. § 290 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 InsO gestellt worden ist. Ein allgemeines Prinzip, dass die Entscheidung im Erstverfahren über einen gewissen Zeitraum Wirkung entfaltet, existiert nicht. So ist nach den einzelnen Versagungsgründen zu differenzieren. Grundlage der Sperrfristrechtsprechung ist aber, dass etwa die Versagungsgründe des § 290 Abs. 1 Nr. 5 und 6 InsO ihrer verfahrensfördernden Funktion beraubt würden, wenn Verstöße nicht nachhaltig sanktioniert werden.
Dem unredlichen Schuldner darf deshalb nicht die Möglichkeit gegeben werden, sofort einen neuen Antrag zu stellen. Gemessen daran ist auch im Anschluss an die Versagung nach § 298 Abs. 1 InsO wegen fehlender Deckung der Mindestvergütung des Treuhänders eine dreijährige Antragssperre angemessen. Der Tatbestand ist mit den Fällen vergleichbar, in denen die verfahrensfördernde Funktion der Versagungstatbestände beeinträchtigt ist, weil der Schuldner trotz Belehrung Antragsmöglichkeiten nicht wahrnimmt und damit von der Allgemeinheit zu tragende Kosten verursacht. Dieses Verhalten wiederum entspricht der in § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO sanktionierten Vermögensverschwendung, bei der ebenfalls eine dreijährige Sperrfrist gilt.
Eine Vermögensverschwendung liegt nämlich nach Auffassung des Bundesgerichtshofes auch vor, wenn der Schuldner es trotz Aufforderung nach § 298 Abs. 1 Satz 1 InsO unterlässt, mit vorhandenen Mitteln die Treuhändervergütung zu begleichen oder im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen für eine Kostenstundung trotz Hinweis des Gerichts keinen Stundungsantrag stellt, um damit die Versagung nach § 298 Abs. 1 Satz 2 InsO abzuwenden.
Mit der hier zitierten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof Klarheit dahingehend geschaffen, dass eine Sperrwirkung auch im Falle des § 298 InsO gerechtfertigt ist. Der Bundesgerichtshof hat dabei zu Recht darauf hingewiesen, dass die Sanktion des § 298 Abs. 1 Satz 1 InsO ohne Anordnung einer Sperrfrist weitestgehend wirkungslos bliebe. Denn der Schuldner hätte dann die freie Wahl, ob er die Vergütung des Treuhänders begleicht oder ob er die Versagung der Restschuldbefreiung hinnimmt und sofort wieder ein neues Verfahren beginnt, in welchem die gesamten Verfahrenskosten noch einmal anfallen.